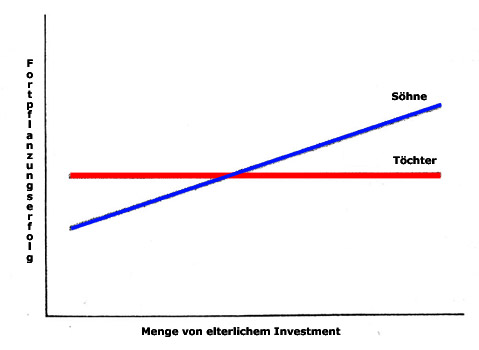Einleitung
Vor einem Jahr habe ich, angeregt durch den Ameisenspezialisten Joachim Schumann, eine erste Untersuchung zum Einfluss von Zufütterung auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bei Lasius niger vorgenommen.
Dem bisherigen Wissensstand nach, nimmt eine Ameisenkönigin in der Natur nach der Gründung erstmals Nahrung auf, wenn die ersten Arbeiter auf Nahrungssuche gehen.
Bis zu diesem Zeitpunkt zehrt die gründende Königin von ihrer Flügelmuskulatur und anderer, in der Gaster bereits vorhandener Nahrung. Mit dieser Energie muss sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Larven versorgen.
Ob Königinnen aber auch schon vor diesem Zeitpunkt Nahrung mit positivem Effekt auf ihre Brut verwerten können, ist bisher der Wissenschaft unbekannt.
Material und Methoden
Die Untersuchung wurde mit 20 Königinnen von Lasius niger vorgenommen, welche während der Schwärmphase im engen Umkreis aufgesammelt wurden. Es ist aus diesem Grund anzunehmen, dass die schwärmenden Königinnen bis zu diesem Zeitpunkt ähnlichen Bedingungen ausgesetzt waren.
Nach dem Einfangen wurden die Königinnen in 10 cm lange, durchsichtige Röhrchen mit 2 cm Durchmesser gesetzt, der Ausgang wurde mit Watte verschlossen. Die Versuchstiere erhielten am Ende des Röhrchens einen Tropfen Wasser bzw. Zuckerwasser, der nachgefüllt wurde, falls nötig. 10 Versuchstiere erhielten ausschließlich Wasser, die 10 anderen Zuckerwasser.
Bei ca. 28 °C wurden die Röhrchen in einem dunklen, ruhigen Ort stabil untergebracht, um Störungen zu vermeiden.
Einmal am Tag wurde die Eizahl, Larvenzahl, Puppenzahl und Arbeiterzahl von außen visuell aufgenommen oder, falls sie nicht zählbare Ausmaße annahmen, geschätzt.
Mit Hilfe der Software SPSS 16.0 wurde der Unterschied zwischen den Eizahlen, Larvenzahlen, Puppenzahlen und Arbeiterzahlen statistisch auf Signifikanz überprüft, dazu wurde eine Varianzanalyse mit Messwiederholung angewendet.
Die Diagramme zu den entsprechenden Untersuchungen beginnen am Tag des Erstauftretens des entsprechenden Ameisen-Einwicklungsstadiums und enden ca. 2 Wochen nach Erstaufnahme (4 Wochen bei den Arbeitern).
Ergebnisse
Die Eianzahl unterscheidet sich nicht signifikant zwischen nicht zugefütterten und zugefütterten Ameisenköniginnen (p=0,56, n=10, Fig.1). Das gleiche gilt auch für die Larvenzahl (p=0,998, n=10, Fig.2). Die Anzahl der Puppen hingegen zeigt eine leichte Tendenz zu einer erhöhten Zahl bei den zugefütterten Königinnen (p=0,169, n=10, Fig.3). Ein signifikanter Unterschied tritt nur bei der Arbeiterzahl auf, bei den zugefütterten Königinnen traten ab Tag 46 nach Einsetzen erste Arbeiter auf, bei den anderen bis Tag 71 keine (p<0,001, n=10, Fig.4).
Diskussion
Zufütterung hat bei Königinnen von Lasius niger einen Einfluss, der erst bei dem erstmaligen Auftreten von Arbeitern deutlich erkennbar ist. Es ist anzunehmen, dass der Fortpflanzungsvorteil von zugefütterten Königinnen erst nach dem Auftreten der Larven bemerkbar wird, da diese mit der vorhandenen Nahrung gefüttert werden können.
Mit diesem Experiment ist bewiesen, dass Königinnen von Lasius niger Nahrung schon während der Gründungsphase, bevor die ersten Arbeiter eintreffen, sinnvoll verwerten können. Dadurch können sie ihrer Kolonie einen Entwicklungsvorteil gegenüber Königinnen verschaffen, die von ihrer Flügelmuskulatur zehren müssen.
Unter natürlichen Verhältnissen bedeutet die Nahrungssuche allerdings einen nicht zu vernachlässigenden Energieaufwand und Risiko, von Prädatoren erbeutet zu werden. Aus diesem Grund scheint es der Fitness der Ameisen zuträglicher, versteckt in der Höhle zu bleiben und mit den Körperreserven auszukommen.
In weiteren Experimenten, die demnächst folgen werden, werde ich eine höhere Stückzahl zur Untersuchung des gleichen Sachverhaltes anstreben und evtl. weitere Nahrungsarten und ihren Einfluss untersuchen.




Ameisenfoto: © Jens Buurgaard Nielsen/qcpages.qc.edu