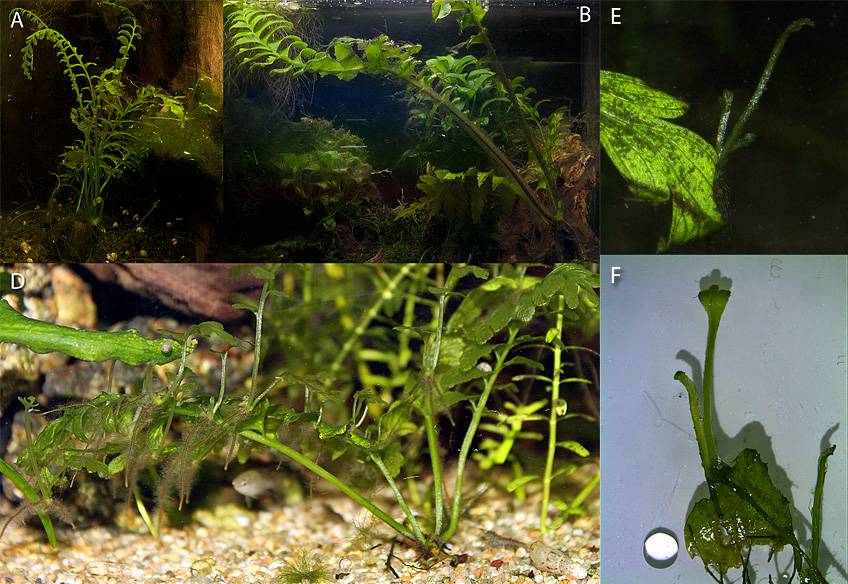Das sekundäre Xylem, das Hauptwasserleitsystem der Blütenpflanzen, wird während der Dickenwachstumsphase gebildet und umgangssprachlich als Holz bezeichnet. Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit, es wird seit ungefähr einer halben Million Jahren mit Werkzeugen bearbeitet, um es für verschiedene Einsatzzwecke nutzbar zu machen.
Viele Sagen und Gerüchte ranken sich um japanische Stemmeisen, welche eines der ältesten Holzbearbeitungswerkzeuge der Welt darstellen und dazu dienen, Zapfen und Löcher für zahlreiche Holzverbindungen anzufertigen. Positive Stimmen schwärmen von der überlegenen Qualität dieser in mühsamer Handarbeit von erfahrenen Schmieden hergestellten Eisen. Stattdessen verurteilen Kritiker die Empfindlichkeit der Eisen; sie bevorzugen die maschinell hergestellten Exemplare, welche unempfindlich genug sind um Nägel zu entfernen. Während westliche Modelle also als Allrounder ausgelegt sind, haben sich die Japaner als Ziel gesetzt, die Holzarbeit mit hochspezialiertem Werkzeug zu perfektionieren. Aus diesem Grund bestehen die westlichen Werkzeuge aus einem einheitlichen, sehr harten Stahl, während die Japaner einen zweilagigen Typ bevorzugen; eine harte Schneidenschicht (jap. „Hagane“) unten wird mit einer weichen Trägerschicht (jap. „Jigane“) zusammengeschmiedet; der Schmiedeprozess muss sehr individuell auf jedes einzelne Eisen ausgerichtet sein. Das führt dazu, dass maschinelle Perfektion bei japanischen Eisen auch heute nicht an die Qualität erfahrener japanischer Schmiede in Ein-Mann-Betrieben herankommen kann.
Wider Erwarten zählt nämlich weniger die Qualität des Stahls als die angewandte Handarbeit. Zum Schmieden der Schneidenschicht von Werkzeugen werden in Japan vornehmlich zwei verschiedene Stahlarten angewandt. Die erste wird als „weißer Papierstahl“ oder „white steel“ (jap. „Shirogami Steel“) bezeichnet, während die zweite unter dem Namen „blauem Stahl“ oder „blue steel“ (jap. „Aogami steel“) geführt wird. Allerdings unterscheiden sich diese Stahlarten wider Erwarten nicht in ihrer Farbe, sie werden lediglich in weiß oder blau gefärbtem Papier geliefert. Beide Stahlarten entspringen einem Grundstahl von Hitachi, der als JIS SK-Stahl bezeichnet wird. Dieser Stahl enthält sehr vielen ungewünschte Verunreinigungen wie Schwefel und Phosphat und wird daher einigen Reinigungsprozessen unterzogen, bis ein sehr reiner Stahl mit hohem Karbongehalt (ca. 1% Karbon) entsteht, der als „White Steel #2“ bezeichnet wird. Von diesem Stahl aus gibt es zwei verschiedene mögliche Vorgehensweisen. Fügt man diesem Stahl mehr Karbon zu, entsteht „White Steel #1“, welcher inflexibler ist. Das führt zu einer erhöhten Härte, aber leider auch zu einer reduzierten Zähigkeit. Die zweite Möglichkeit ist es, dem „White Steel #2“ mehr Karbon und zusätzlich noch Wolfram zuzusetzen. Das führt zu „Blue Steel #2“, einem Stahl mit reduziertem Abrieb, welches ihn allerdings auch schwieriger zu schärfen macht (der Schärfprozess umfasst einen kontrolliert erzeugten Abrieb). Erweitert man den „Blue Steel #2“ nun mit noch mehr Karbon, Wolfram und Chrom, erhält man „Blue Steel #1“, der wie bei seinem weißen Äquivalent härter, aber auch spröder wird. Der Abrieb von „Blue Steel #1“ lässt sich durch eine weitere Addition von Carbon, Wolfram, Molybdän und anderen Legierungskomponenten noch weiter reduzieren; das Resultat wird auch als „Super Blue Steel“ bezeichnet. Viele dieser Stahlarten werden durch Schmiede weiter verfeinert, indem sie eingeschmolzen werden. Anschließend wird das flach gegossene und geklopfte Eisen zertrümmert, um nur die reinsten Bestandteile für die Weiterverarbeitung auszuwählen. So gibt es für fast jede Schmiede eine eigen bezeichnete Stahlart.
Interessant für die Beurteilung japanischer Schmiedekunst ist es, dass weißer Stahl aufgrund des Fehlens seltener Mineralien relativ billig ist, während blauer Stahl mit hohen Preisen zu Buche schlagen kann. Allerdings ist weißer Stahl deutlich schwieriger zu schmieden; die optimalen Eigenschaften lassen sich nur erreichen, wenn peinlich genau auf die Temperatur während der Glüh-, Härte- und Anlassprozesse geachtet wird; wird er einige Grade heißer, erreicht das Produkt nur eine minderwertige Qualität. Blauer Stahl hingegen ist sehr temperaturtolerant und erlaubt es, auch etwas ungenauer zu arbeiten; so können selbst mittelmäßige Schmiede Qualitäten oberen Niveaus erreichen. Durch den höheren Preis des Materials wird die billigere Schmiedearbeit allerdings wieder aufgewogen.
Optimale Bearbeitung vorausgesetzt, sind Stemmeisen aus blauem Stahl ein bisschen zäher und behalten ihre Schärfe länger. Stattdessen sind die Eisen aus weißem Stahl leichter zu schärfen und die Klinge erhält eine höhere Schärfe als die aus blauem Stahl. Aus diesen Gründen wird für die Bearbeitung von Weichholz gerne zu weißem Stahl gegriffen, während Stemmeisen aus blauem Stahl bei extrem harten Hölzern zum optimalen Werkzeug werden. Die bei japanischen Stemmeisen oben liegende Trägerschicht soll zwecks optimaler Schärfbarkeit möglichst weich sein (sie enthalten ca. 0.25 % Karbon); ansonsten spielt sie eine untergeordnete Rolle in der Qualität eines japanischen Stemmeisens. Aus diesem Grund verwenden erfahrene japanische Schmiede Stahl, welcher vor 1900 hergestellt wurde. Dazu schmelzen sie alte Ankerketten, Bahngleise oder sogar Öfen ein. Diese alten Stahlarten enthalten – im Vergleich zu den heute sehr reinen Industriestählen – deutlich mehr Verunreinigungen wie Silikonpartikel. Diese sind bei einer weichen Trägerschicht durchaus gewünscht. Des Weiteren verwenden viele Schmiede die Trägerschicht, um die Ästhetik des Eisens zu verbessern; früher war es selbst den japanischen Meisterschmieden kaum möglich, ihre besten, aber normal aussehenden Eisen zu hohen Preisen an westliche Tischler zu verkaufen. Aus diesem Grund griffen die Schmiede zu Damaszenerstahl und produzierten Stemmeisen mit einer Oberflächenstruktur, die natürlicher Holzmaserung ähnelte (als „Mokume“ bezeichnet). Diese Zierde liegt lediglich in der Trägerschicht und hat keinen Einfluss auf die Qualität der dann auch meisterhaft geschmiedeten Schneide. So bietet heute jeder bekannte japanische Schmied seine Stemmeisen auch um solche Ziermuster verschönert – was aufgrund des nötigen Aufwandes auch einen höheren Preis fordert – an. So spielt bei hochpreisigen japanischen Stemmeisen die Ästhetik und dahinter steckende Spiritualität – neben dem kleinen Angebot von Ein-Mann-Betrieben und der möglichen hohen Nachfrage durch den Bekanntheitsgrad – eine sehr wichtige Rolle.
Die Spannweite japanischer Stemmeisen erstreckt sich über zahlreiche Anwendungsbereiche. Waren diese Eisen – wie der Name sagt – ursprünglich ausschließlich zum Ausstemmen von Löchern gedacht, so existieren heute vielfältige Abwandlungen, die in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen wahre Spezialisten sind. Die normalen, mit einer Seitenfase, aber in einer planen Fläche endenden Stemmeisen, englisch unter dem Begriff „bench chisels“ laufend, werden von den Japanern „oire nomi“ genannt. Es handelt sich um den Archetyp der Stemmeisen, der mit seiner stabilen Form einen sehr guten Allrounder darstellt. Hingegen sind die Zinkenstemmeisen („dovetail chisels“ bzw. „umeki nomi“) vor allem zum Anfertigen von Zinkenverbindungen gedacht. Die in einer Dreiecksform aufeinander zulaufenden Seitenfasen erlauben es hierbei, die normalerweise unzugänglichen Ecken von Schwalbenschwänzen sauber auszustechen. Lochbeitel („mortise chisel“ bzw. „mukoumachi nomi“ haben eine nicht abgeschrägte Seite und eine sehr dicke Klinge. Dieser Bau erlaubt es, mit diesen Eisen tiefe Löcher auszustemmen; Hebelbewegungen, die bei anderen Eisen zu einem Bruch der Klinge führen würden, sind hiermit machbar. Zimmermannsbeitel („paring chisels“ bzw. „usu nomi“) sind sehr dünn und dadurch im Gegensatz zu den anderen Eisen nicht zum Schlagen mit einem Hammer gedacht. Feinste Schnitzarbeiten können per Hand mit Hilfe dieser Eisen durchgeführt werden; die dünne Klinge erlaubt es, Stellen zu erreichen, die ansonsten unzugänglich wären.
Unter japanischen Werkzeugschmieden gibt es ebenso wie bei Waffenschmieden einige weltbekannte Namen. Diese Meister ihres Handwerks haben oft über 50 Jahre Erfahrungen sammeln können, da die Schmiedetechniken sich die letzten Jahrzehnte hinaus kaum verändert hat. Das schlägt sich in hochwertigen Stemmeisen nieder, die sehr scharf sind und selbst beim Bearbeiten extrem harter Holzsorten diese Schärfe nicht verlieren, so dass im Gegensatz zu preiswerteren Modellen nur selten nachgeschliffen werden muss. Der wohl weltweit bekannteste Name unter den Stemmeisenschmieden ist Akio Tasai. Zusammen mit seinem jungen Sohn schmiedet er Eisen aus einem als „Yasuki Steel“ bezeichneten, dem „Blue Steel“ sehr ähnlichen Stahl. Sein Markenzeichen sind die „Mokume“-Eisen, welche sich durch eine sehr schön bearbeitete Oberfläche auszeichnen – außer ihm und seinem Sohn beherrscht kein anderer Schmied die von ihm angewandte Technik. Ein anderer, in der westlichen Welt bekannter Meister seiner Kunst ist Chutaro Imai, der seine Eisen unter dem Großhandelsnamen „Fujihiro“ vertreibt. Auch als „Sword steel chisels“ bezeichnet, bestehen seine Eisen aus einem weißen Stahl mit hohem Karbongehalt. Andere bekannte Namen sind der in den letzten Jahren verstorbene Yamazaki Shouzoh (Hidari Ichihiro) der mit „White Steel #1“ arbeitete sowie Oohkubo Teiichirou (Daitei), Funahiro Funatsu, Yoshiro Ikeda (Kunikei), Yasushi Hanyu, Matsumura, Ouchi, Iyoroi, Kikuhiromaru, Watanabe Kiyoei (Kiyohisa) und Hidari Konobu.
Falls durch diesen Artikel euer Interesse geweckt werden sollte, ist Herr Dieter Schmid im deutschsprachigen Raum als einer der führenden Verkäufer von japanischen Stemmeisen zu empfehlen. Für dort nicht verfügbare japanische Stemmeisen müssen Händler aus dem Ausland zu Rate gezogen werden, zu empfehlen sind die Shops Japantool Iida und Japan tool. Bei allen diesen Händlern möchten wir uns für die zur Verfügung gestellten Fotos bedanken.